Der unsichtbare Endgegner in Sachen Digitalisierung
- Nadine Sporea

- 1. Okt. 2024
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 16. Juli 2025
Einer meiner Kunden sagte einmal zu mir, er wisse nicht, was an der Digitalisierung eigentlich so schwer sei, denn gute digitale Lösungen schössen doch wie Pilze aus dem Boden.
Das stimmt - an guten Lösungen fehlt es nicht und die schlechten verschwinden fix auch wieder.
Warum tun wir uns dann eigentlich so schwer mit diesem Giganten unter den Herausforderungen?
In einer Singapore Management University (et al) Studie aus dem Jahr 2020 kamen 87% der befragten Menschen in hohen Führungspositionen zu dem Schluss, dass ihre Unternehmenskultur eine der größten Hürden bei der Bewältigung der Hausforderungen der Digitalisierung sei.
Das gleicht einer Studie aus dem Jahr 2016, in dem C Level Befragte Änderungen an Kultur und Organisation als den am Meisten durch die Digitalisierung veränderten Bereich in ihren Unternehmen sah.
Die Erkenntnis, dass Technologisierung und Digitalisierung also Einfluss auf die Kultur haben und umgekehrt die Kultur ein Faktor für Erfolg oder Misserfolg der digitalen Transformation ist, scheint ja doch angekommen zu sein.
Wie kann etwas so wichtig sein und doch nicht im Fokus?
Ich finde das insofern interessant, dass sich diese Gewichtigkeit so gut wie nie in den Budgets der Umsetzung von Digitalisierungsinitiativen widerspiegelt.
Vielmehr wird viel Geld in die aktuell spannendste Technologie investiert. Das Change Management muss dann durch die Projektleitung nebenher mit passieren, samt Kulturwandel, bitte ohne viel Aufhebens. Für die Technologie holen wir uns Profis, für den Kulturwandel nicht.
Diese Diskrepanz vermag vielleicht die Lücke zu erklären zwischen der Verfügbarkeit technologischer Lösungen und ihrem Einsatz, speziell im deutschen Mittelstand.
Woher kommt der Gegenwind?
Zu einfach ist an dieser Stelle der (Kurz-)Schluss: es liegt am Widerstand der Mitarbeiter. Der Deutsche ansich ist ja total gegen Veränderungen.
In meiner Erfahrung sind die Mitarbeiter durchaus offen für Technologien, die ihren Arbeitsalltag erleichtern und können sich schnell an veränderte Arbeitsabläufe anpassen.
Oft entpuppen sich Technologiewiderständler als gebrannte Kinder, die gefrustet sind von halbfertigen Technologie Flickenteppichen, die nie zu einem Ganzen wachsen und merken, dass nicht die Software, sondern schlicht die Umsetzung keinen Mehrwert und im schlimmeren Fall noch mehr Arbeit mit sich bringt.
Wie die Digitalisierung die Kultur stresst
Der digitale Wandel hat mit der Abschaffung des Faxgeräts wenig zu tun. Die eigentliche Veränderung findet im Unterbauch des Unternehmens statt, in der Kultur.
Kultur = Werte + Verhalten
Und es lohnt sich ein Blick auf eben jene Verhaltensweisen und Werte, die für erfolgreiche Digitalisierung gebraucht werden.
Welche Werte und Verhaltensweisen braucht Digitalisierung?
Die Digitalisierung (und das überrascht noch immer viele) ist mehr als der Kauf teurer Softwarelizenzen und ein bisschen Projektmanagement. Sie ist komplex, verlangt radikale Prozessexzellenz und fördert schonungslos zu Tage, wo in den Strukturen des Unternehmens gemurkst wird. Sie fordert den Umbau ganz großer Abläufe zugunsten standardisierter Datenströme und Prozesse rüttelt an Entscheidungswegen und Rollen gleichermaßen.
Das erzeugt in maximaler Gleichzeitigkeit eine irrwitzige Komplexität.
Und diese Komplexität lässt sich nicht mehr durch rigide Planung und enges Management lösen, sondern nur noch durch Versuch und Irrtum, durch geballte Sammelintelligenz und mit dem Willen, neue Probleme mit neuen Methoden zu lösen. Wer digitalisiert muss zwangsläufig in Kauf nehmen, nicht alle Antworten zu haben und mit Problemen konfrontiert zu sein, die er so noch nicht kannte, Fehler zu machen, die keiner vorhersehen konnte und Risiken zu managen, während sie passieren.
Sowohl die Bereitschaft, sich mit Versuch und Irrtum fortzubewegen, als auch das Lernen aus Letzterem führen uns weg vom klassischen Command & Control alter Managementschulen hin zur agileren, flexibleren und moderneren Strukturen und Methoden. Das verlangt vielen Chefs der alten Schule eine Portion Vertrauen ab, das sie, sind wir ehrlich, oft nicht haben. Bringen Sie Und wenn sie Deshalb wird den neuen Herausforderungen auch konsequent mit den alten Methoden begegnet, obwohl sie schon oft bewiesen haben, dass sie nicht passen.
Und so bleibt die Komplexität der Digitalisierung in einzelnen Kompetenzflaschenhälsen hängen, weil der Chef immer entscheiden muss. So scheint die Baustelle so groß, dass sie nicht zu bewältigen ist, weil ein iteratives Vorgehen abgelehnt wird. So wird von Projekten zu viel verlangt, sind die Portionen unverdaubar groß, weil der Change mit abgefrühstückt werden muss. Und so wird am Ende ein Projekt gelauncht, das viel gekostet hat und doch nicht tut, was es soll, weil das Unternehmen nicht radikal auf den Kundennutzen ausgerichtet wird.
Wir können da auch noch ein paar Jahre drüber reden und jeden Tag ein bisschen weniger konkurrenzfähig werden. Oder wir stellen uns endlich dem unsichtbaren Endgegner in Sachen Digitalisierung: dem Kulturwandel.
Wenn Sie Lust haben, Ihre Kultur auf die Probe zu stellen, machen Sie doch HIER unseren kostenlosen Resilienz Schnelltest. Oder treten Sie für eine intensive Analyse Ihrer Kultur mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf Sie.
Nadine Sporea ist freiberufliche Organisationsentwicklerin und systemische Coachin im Netzwerk von disruptiOconsult. Sie schreibt und berät zu Themen wie digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und agile Organisationsentwicklung – immer mit klarem Kompass, scharfem Blick und einem Augenzwinkern. Ihre Beiträge spiegeln ihre unabhängige Perspektive wider und sind Teil ihrer selbstständigen Tätigkeit. Verantwortung für Nebenwirkungen übernimmt ausschließlich das System.


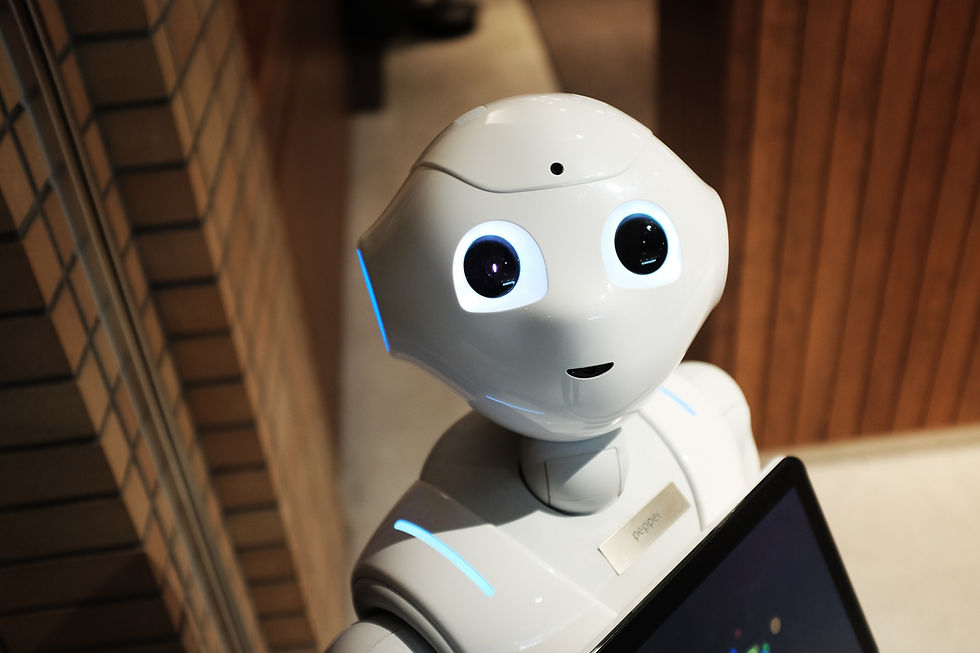

Kommentare